Eclipsium: Zwischen Traum und Albtraum – Review

Wenn man Eclipsium startet, fühlt es sich an, als werde man mitten in einen Albtraum geworfen, ohne Erinnerung, ohne Orientierung und doch mit einer zielstrebigen Hoffnung. Man wacht in einem fremden Zimmer auf, sieht den Turm in der Ferne und spürt sofort: Hier geht es nicht darum, Monster zu jagen oder Gegner zu bezwingen, sondern darum, sich durch Dunkelheit und Verzerrung zu kämpfen. Dieses Gefühl des Verlorenseins, dieses Ziehen nach Licht, das niemals ganz greifbar scheint, definiert das Erlebnis von Eclipsium.
Zwischen Licht und Schatten: Die Welt von Eclipsium
Die Welt von Eclipsium ist surreal, düster und gleichzeitig wunderschön verstörend. Die Entwickler haben Hand-gefertigte Umgebungen geschaffen, die an Kirchen aus Fleisch, verfallene Wälder, Gänge, die sich winden, und Räume, die ihre Perspektive verändern, erinnern. Man schreitet durch Bereiche, in denen das Licht kaum ausreicht, um Formen zu erkennen, und Schatten sich über Objekte legen, bis sie fast verschwinden. Doch es gibt Licht, das Pulsieren, das Transformieren. Hier wechselt die Umgebung nicht einfach als Kulisse, sie atmet, sie verschiebt sich, sie reizt das Vorstellungsvermögen.
Die Musik und das Sounddesign tragen einen großen Teil dazu bei, dass diese Welt nicht bloß bedrohlich, sondern emotional greifbar wird. Es sind nicht laute Schreie oder plötzliche Jumpscares, die Angst erzeugen, sondern das leise Knacken von Holz, das Rauschen eines verfaulten Windes, das Echo der eigenen Schritte in einer Halle, in der die Decke nicht ganz stabil wirkt. Der Soundtrack mit über 20 selbst komponierten Stücken verstärkt diese Stimmung, lässt Momente innehalten und steigert sie dann bis zur schmerzlichen Erwartung.
 © Housefire / CRITICAL REFLEX
© Housefire / CRITICAL REFLEX
Wie man sich bewegt, sieht und fühlt
Eclipsium spielt sich in der Ich-Perspektive. Die rechte Hand ist stets sichtbar, ausgestreckt, bereit, Dinge zu greifen oder den Raum zu ertasten. Dieses ständige Sichtbarkeitsmerkmal der Hand wirkt wie eine Verlängerung des eigenen Körpers, aber auch wie ein Hinweis darauf, wie verletzlich man ist. Es gibt kein Kämpfen. Kein Entkommen mit Waffen. Stattdessen verlässt man sich auf Wahrnehmung, Tastsinn und Umweltinteraktion. Türen, Möbelstücke, Gerätschaften liegen in Reichweite, und oft reagiert die Umgebung auf das, was man sieht, berührt oder erwartet.
Die Rätsel sind meist subtil und atmosphärisch eingebettet. Es handelt sich nicht um Puzzle-Herausforderungen, die eine Anleitung fordern, sondern Aufgaben, die das Terrain, das Licht, die Geräusche nutzen. Manche Objekte verformen sich seltsam, manche Räume ändern ihre Bedeutung, sobald man sie erneut betritt. Die Lernkurve ist sanft, am Anfang genügt es, aufmerksam zu sein. Später werden die Umgebungen abstrakter und die Anforderungen an Geduld und Beobachtung steigen.
Erzählen zwischen Traum und Alptraum
Die Story von Eclipsium ist nicht linear erzählt. Es gibt keine Dialoge oder klassische Erzählsequenzen, die erklären, warum man hier ist oder wie alles begann. Stattdessen ist da „Her“ der Lichtschein, die Erinnerung, die Hoffnung. Man verfolgt etwas, das vielleicht real ist, vielleicht aber eine Illusion oder ein Lockruf. Fragmente von Symbolen, Szenen, Bildstöcke tauchen auf: Ruinen, Blut, Körper, Schatten, die sich verformen. Alles wirkt, als sei es Teil eines größeren Mosaiks, das man niemals vollständig sieht.
Diese Erzählweise verlangt, dass man sich einlässt. Wer Kontrolle und Klarheit erwartet, wird sie nicht bekommen. Wer stattdessen Lust hat, Fragen mit sich zu tragen, seine eigene Interpretation zu suchen, wird belohnt. Es gibt in der Gestaltung eine enorme emotionale Dichte, vor allem in Momenten, in denen die Welt sich verwandelt, in denen Licht und Dunkelheit miteinander ringen und man selbst das Gefühl hat, Teil dieser Verwandlung zu sein.

© Housefire / CRITICAL REFLEX
Technik, visuelle Gestaltung und Leistung
Das Grafikdesign ist stilisiert und bewusst roh: lo-fi Texturen, kantige Formen, retroinspiriertes Design, das gleichzeitig surreal wirkt. Es gibt bewusst Verfremdungseffekte, Verzerrungen, Farben, die kaum einander unterscheiden, Schatten, die schlucken statt abgrenzen. Diese Stilentscheidung wirkt stark und ist Teil der Spannung, aber sie bringt auch Probleme mit sich.
Einige Spieler*innen berichten, dass die visuelle Gestaltung in dunklen Bereichen mit niedrigem Kontrast anstrengend für die Augen ist. Objekte sind schwer zu identifizieren, Lichtverhältnisse teilweise so schwach, dass man sich in Szenen länger orientieren muss. In Streams und Foren wird über Kopfschmerzen oder Ermüdung geklagt, wenn man längere Zeit spielt. Es gibt Hinweise darauf, dass das Entwicklerteam visuelle Optionen wie Anpassung der Effekthelligkeit oder Gammakorrektur einbauen will oder bereits teilweise implementiert hat.
Leistungstechnisch läuft Eclipsium auf modernen PCs überwiegend stabil. Da keine High-End-Grafikbomben erwartet werden, sondern stilistische Kompromisse, können Systeme der Mittelklasse das Spiel gut bewältigen. Ob es auf älteren Grafikkarten oder schwacher Hardware wirklich rund läuft, ist abhängig von der genauen Einstellung und Auflösung. Die Steam-Systemanforderungen nennen nur wenige GB Speicherplatz und moderate Hardware, was positiv ist.
Spielzeit und das Ziehen der Erinnerung
Die komplette Reise durch Eclipsium dauert etwa drei bis fünf Stunden, je nachdem, wie gründlich man erkundet und wie oft man in Rätsel passt oder Umgebungen mehrfach betritt. Wer nur dem Hauptweg folgt, ist schneller durch, wer jeden Winkel absucht, versucht, jedes Symbol zu verstehen, und sich auf das Ambiente einlässt, wird länger verweilen.
Der Wiederspielwert liegt nicht in neuen Hafenstädten, sondern in den Nuancen: Unterschiedliche Interpretationen, Beobachtungen, das Gefühl beim Gehen, wenn man erkennt, wie Objekte sich verändern oder wie Licht anders fällt als beim ersten Mal. Auch kleine Szenen, die beim ersten Durchgang fast unscheinbar waren, gewinnen an Bedeutung, wenn man später zurückkehrt.

© Housefire / CRITICAL REFLEX
Stärken
Eclipsium glänzt vor allem mit seiner starken Atmosphäre. Die Mischung aus Kunst, Mystery und Horror erreicht hier ein Niveau, das in vielen Indie-Titeln selten ist. Die Entscheidungen in der Gestaltung – Licht, Schatten, Bewegung und Sound – erzeugen Momente, in denen man wirklich innehält und wahrnimmt, wie der eigene Herzschlag schneller wird.
Die optischen Eigenheiten sind mutig und wirksam. Dieses Zögern vor einem Schatten, das Erschaudern beim Flüstern aus der Dunkelheit, die visuelle Verfremdung – all das macht Eclipsium zu einem Erlebnis, das länger nachhallt als viele actiongeladene Horror-Titel.
Auch das Tempo ist eine Stärke. Es zwingt dazu, achtsam zu sein. Kein Rennen, kein ständiges Vorpreschen, sondern Beobachtung, die Wahrnehmung, das Innehalten. Diese Langsamkeit ist nicht jedem Recht, aber sie eignet sich hervorragend, um die bedrückende Stimmung und das Unbehagen zu steigern.
Schwächen
Die visuelle Gestaltung, so eindrucksvoll sie ist, sorgt auch für Überforderung. In dunklen Szenen leiden Details unter dem niedrigen Kontrast und Effekten, die Schatten und Formen verschmelzen lassen. Wer empfindlich auf Licht/Dunkel-Kontraste reagiert, dem könnten Augen und Gehirn nach längerer Spielzeit schmerzen.
Das Fehlen von offensichtlicher Mechanik oder klarer Handlung wird für manche zur Frustration. Wer Struktur, Ziele oder eine erklärende Story bevorzugt, fühlt sich hier verloren. Manche Rätsel oder Hindernisse sind weniger herausfordernd, sondern wirken wie Brücken, die man passiv überquert, statt wirklich mit ihnen zu interagieren.
Auch das Tempo kann in den späteren Abschnitten zur Geduldsprobe werden, besonders wenn man zurücklaufen muss oder Gegebenheiten wiederholt werden. Die geringe Mobilität, das langsame Gehen, kann in Kombination mit dunklen, wenig unterscheidbaren Räumen ermüdend werden.

© Housefire / CRITICAL REFLEX
Fazit
Eclipsium ist ein starker Titel im Genre des psychologischen Horror‐Abenteuers. Es verbindet visuelle Kunst, Sounddesign und narrative Andeutungen zu einem Erlebnis, das weniger auf Schock als auf Beklemmung setzt. Für Spieler*innen, die bereit sind, sich auf ein eigenwilliges, künstlerisches Spiel einzulassen, bietet es Tiefgang und Nachklang. Wer dagegen klare Handlung, Action oder klassische Komfortfunktionen erwartet, könnte womöglich enttäuscht sein.



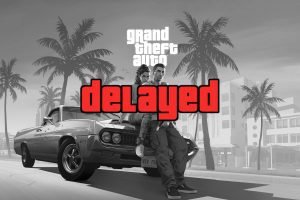







Kommentar veröffentlichen